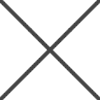StGB § 238: Stalking / Nachstellung: Was ist Stalking / Nachstellung
Sofort-Kontakt:
LAUENBURG | KOPIETZ | HERZOG | HOFFMANN
Rechtsanwälte Strafverteidigung
Tel.: 040 / 39 14 08 (Rückruf-Service)
oder Anwaltsnotdienst außerhalb unserer Bereitschaften.
| JETZT TERMIN VEREINBAREN |
E-Mail: lauenburg@ihr-anwalt-hamburg.de oder Kontaktformular
Anfahrt mit dem Pkw oder ÖPNV.
1. Nachstellung / Stalking gemäß § 238 StGB
2. Was bedeutet „unbefugt“?
3. Was bedeutet „wiederholt“?
4. Was bedeutet „geeignet“ die Lebensgestaltung zu beeinträchtigen?
5. Was bedeutet „nicht unerhebliche“ Beeinträchtigung der Lebensgestaltung?
6. Was ist eine Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des / der Betroffenen?
7.1. Nachstellen / Stalking durch Herstellung physischer Nähe zum Opfer
7.2. Nachstellen / Stalking unter Verwendung von Kommunikationsmitteln oder über Dritte
7.3. Nachstellen / Stalking durch missbräuchliche Nutzung persönlicher Daten, Bestellungen oder Dienstleistungen.
7.4. Nachstellen / Stalking durch Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit
7.5. Nachstellen / Stalking durch Cyberstalking, Ausspähen, Abfangen persönlicher Daten
7.6. Nachstellen / Stalking durch Abbildungen / Rachepornos
7.7. Nachstellen / Stalking durch Urhebertäuschung durch Fakeaccounts des Opfers
7.8. Nachstellen / Stalking durch vergleichbare Handlungen (Auffangtatbestand)
8. Besonders schwere Fälle der Nachstellung / Stalkings
9. Tod durch Nachstellen / Stalking
10. Reform des Stalking- / Nachstellungstatbestands
11. Welche Strafe droht bei einer Verurteilung wegen Nachstellens / Stalkings?
12. Sie können ohne Strafverteidiger / Fachanwalt für Strafrecht gegen den Vorwurf des Stalkings / der Nachstellung nicht bestehen
13. Untersuchungshaft zur Gefahrenabwehr
14. Was Betroffene tun können
1. Nachstellung / Stalking gemäß § 238 StGB
Stalking, juristisch Nachstellung, ist die unbefugte, nicht nur vorübergehende, willentliche und wiederholte (früher: beharrliche) Kontaktaufnahme, das Verfolgen oder das Belästigen einer Person, die geeignet ist, diese nicht unerheblich in ihrer physischen oder psychischen Unversehrtheit, Lebensgestaltung, Lebensführung, Lebensumstände oder Gewohnheiten unmittelbar, mittelbar oder langfristig zu beeinträchtigen.
Nachstellen umfasst sämtliche Handlungen, die „darauf ausgerichtet sind, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherungen an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen.“ BT-Drucks. 16/575, Seite 7; BeckOK StGB/Valerius § 238 Rn. 4
1.1. Gemäß BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09 - StraFo 2010, 166 setzt beharrliches Handeln gemäß § 238 StGB wiederholtes Tätigwerden voraus. Der Täter handelt aus Missachtung des entgegenstehenden Willens oder aus Gleichgültigkeit gegenüber den Wünschen des Opfers in der Absicht, sich auch in Zukunft entsprechend zu verhalten. Eine in jedem Einzelfall Gültigkeit beanspruchende, zur Begründung der Beharrlichkeit erforderliche (Mindest-)Anzahl von Angriffen des Täters kann nicht festgelegt werden.
1.2. Die Lebensgestaltung des Opfers wird schwerwiegend beeinträchtigt, wenn es zu einem Verhalten veranlasst wird, das es ohne Zutun des Täters nicht gezeigt hätte und das zu gravierenden, ernst zu nehmenden Folgen führt, die über durchschnittliche, regelmäßig hinzunehmende Beeinträchtigungen der Lebensgestaltung erheblich und objektivierbar hinausgehen.
1.3. § 238 StGB ist kein Dauerdelikt. Einzelne Handlungen des Täters, die erst in ihrer Gesamtheit zu der erforderlichen Beeinträchtigung des Opfers führen, werden jedoch zu einer tatbestandlichen Handlungseinheit zusammengefasst, wenn sie einen ausreichenden räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufweisen und von einem fortbestehenden einheitlichen Willen des Täters getragen sind.
§ 238 StGB ist durch das 40. Strafrechtsänderungsgesetz vom 22. März 2007 (BGBl I 354) in das Strafgesetzbuch eingefügt worden. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten mit der Norm beharrliche Nachstellungen, die einschneidend in das Leben des Opfers eingreifen und unter dem englischen Begriff „Stalking“ diskutiert werden, über die bereits bestehenden und in Betracht kommenden Straftatbestände – wie etwa der Nötigung (§ 240 StGB), Bedrohung (§ 241 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB) oder des Zuwiderhandelns gegen eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz (§ 4 GewSchG) – hinaus mittels eines weiteren Straftatbestandes verfolgt werden können, um auf diese Weise einen besseren Opferschutz zu erreichen und Strafbarkeitslücken zu schließen (BTDrucks. 16/575 S. 1; Buettner ZRP 2008, 124; zur vorherigen Rechtslage vgl. Valerius JuS 2007, 319, 320; s. auch Kinzig ZRP 2006, 255, 256 mit Ausführungen zu Regelungen in den USA, den Niederlanden und Österreich). Der neue Straftatbestand dient damit dem Schutz der eigenen Lebensführung vor gezielten, hartnäckigen und schwerwiegenden Belästigungen der Lebensgestaltung (Mosbacher NStZ 2007, 665).
Der u. a. in § 292 Abs. 1 Nr. 1 StGB, § 329 Abs. 3 Nr. 6 StGB verwendete Begriff des Nachstellens erfasst das Anschleichen, Heranpirschen, Auflauern, Aufsuchen, Verfolgen, Anlocken, eine Falle stellen und das Treibenlassen durch Dritte (Kinzig/Zander JA 2007, 481, 483; Valerius aaO S. 321). Im Kontext des § 238 StGB umschreibt der Begriff im Grundsatz damit zwar alle Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherungen an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen (BTDrucks. 16/575 S. 7; Wolters in SK-StGB § 238 Rdn. 7). Jedoch sind in § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StGB die Handlungsformen abschließend beschrieben, auf die sich die Pönalisierung erstreckt. Während allerdings § 238 Abs. 1 StGB in seinen Nr. 1 bis 4 näher konkretisierte Tatvarianten umschreibt, öffnet § 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB das Spektrum möglicher Tathandlungen in kaum überschaubarer Weise, indem er ohne nähere Eingrenzungen jegliches Tätigwerden in die Strafbarkeit einbezieht, das den von § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 StGB erfassten Handlungen „vergleichbar“ ist. Ob Letzteres im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot Bedenken begegnen könnte, bedarf hier indes keiner näheren Betrachtung.
2. Was bedeutet „unbefugt“?
Tathandlung des § 238 Abs. 1 StGB ist das unbefugte Nachstellen durch beharrliche unmittelbare und mittelbare Annäherungshandlungen an das Opfer und näher bestimmte Drohungen auch durch Telekommunikationsmittel im Sinne des § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StGB.
Das Nachstellen ist unbefugt, wenn sich der Täter weder auf eine amtliche noch auf eine privatautonome Befugnisnorm noch auf das Einverständnis des Opfers berufen kann. Wessels/Hettinger/Engländer Strafrecht BT I Rn. 343. Unbefugt handelt nicht, wer im Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit, freien Meinungsäußerung, Religionsausübung und deren rechtlichen Grenzen und sozial adäquaten Handlungsweisen im Zusammenleben sich bewegt.
Das Tatbestandsmerkmal entfällt, wenn der / die Betroffene ausdrücklich oder stillschweigend (=konkludent) einverstanden ist, d. h., dass sich das tatbestandsausschließende Einverständnis auf die konkreten belästigenden Verhaltensweisen und die damit verbundene schwerwiegende Beeinträchtigung der eigenen Lebensgestaltung bezieht. Entsprechend handelt ein Täter unbefugt, wenn er einen grundsätzlich einverstandenen, nicht abgeneigten Betroffenen mit Mitteln der Art und Intensität in der Lebensgestaltung beeinträchtigt, die nicht mehr vom Einverständnis gedeckt sind.
Des Weiteren muss der Täter dem Opfer wiederholt (und nicht mehr wie in einer früheren Gesetzesfassung „beharrlich“) nachstellen. Ob dieses Tatbestandsmerkmal verwirklicht ist, hängt im Einzelfall von der Intensität der Handlungen und der dazwischen liegenden zeitlichen Distanz ab. Grundsätzlich reicht ein einmaliges Handeln nicht aus. Eine wiederholte Nachstellung kann aber bei zweimaligem Handeln angenommen werden, wenn die einzelne Handlung besonders schwerwiegend ist. Unerheblich ist, ob der Täter wiederholt dieselbe Handlungsweise verwirklicht oder ob er verschiedenartige Erscheinungsformen der Nachstellung begeht.
3. Was bedeutet „wiederholt“?
Der Täter muss dem Opfer wiederholt (und nicht mehr wie in einer früheren Gesetzesfassung „beharrlich“) nachstellen. Im Einzelfall hängt die Tatbestandserfüllung von dem Verhältnis / der Relation zwischen der Intensität der Handlungen und dem zeitlichen Abstand und der Anzahl der Wiederholungen ab. Grundsätzlich reicht ein einmaliges Handeln nicht aus. Eine Wiederholung im Sinne des Tatbestandes der Nachstellung kann bei zweimaliger Beeinträchtigung gegeben sein, wenn die einzelne Handlung besonders schwerwiegend ist. Unerheblich ist, ob der Täter wiederholt dieselbe oder andere Tatbestände der Nachstellung verwirklicht.
Exkurs:
Der Begriff „beharrlich“, jetzt „wiederholt“ wird auch an anderer Stelle im StGB verwendet (§ 56f Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 67g Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 70 b Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 184e StGB) und dort regelmäßig als wiederholtes Handeln oder andauerndes Verhalten interpretiert, das eine Missachtung des Verbots oder Gleichgültigkeit des Täters erkennen lässt (Fischer aaO § 184e Rdn. 5; Valerius aaO S. 322; vgl. auch BGHSt 23, 167,172 f.). In § 238 Abs. 1 StGB dient das Merkmal einerseits dazu, den Tatbestand einzuschränken. Andererseits soll es die Deliktstypik des „Stalking“ zum Ausdruck bringen und einzelne, für sich genommen vom Gesetzgeber als sozialadäquat angesehene Handlungen (BTDrucks. 16/575 S. 7) von unerwünschtem „Stalking“ abgrenzen (Kinzig/Zander aaO S. 484; insoweit kritisch Mitsch aaO S. 1240). Dem Begriff der Beharrlichkeit, jetzt Wiederholung, im Sinne des § 238 StGB wohnen objektive Momente der Zeit sowie subjektive und normative Elemente der Uneinsichtigkeit und Rechtsfeindlichkeit inne (Fischer aaO § 238 Rdn. 19; Wolters aaO Rdn. 15); er ist nicht bereits bei bloßer Wiederholung erfüllt. Vielmehr bezeichnet das Tatbestandsmerkmal eine in der Tatbegehung zum Ausdruck kommende besondere Hartnäckigkeit und eine gesteigerte Gleichgültigkeit des Täters gegenüber dem gesetzlichen Verbot, die zugleich die Gefahr weiterer Begehung indiziert. Eine wiederholte Begehung ist danach zwar immer Voraussetzung, genügt aber für sich allein nicht (Lackner/Kühl aaO Rdn. 3; Gazeas JR 2007, 497, 502). Erforderlich ist vielmehr, dass aus Missachtung des entgegenstehenden Willens oder aus Gleichgültigkeit gegenüber den Wünschen des Opfers mit der Absicht gehandelt wird, sich auch in Zukunft immer wieder entsprechend zu verhalten. Der Wiederholung ist immanent, dass der Täter uneinsichtig auf seinem Standpunkt besteht und zäh an seinem Entschluss festhält, obwohl ihm die entgegenstehenden Interessen des Opfers bekannt sind. Die erforderliche ablehnende Haltung und gesteigerte Gleichgültigkeit gegenüber dem gesetzlichen Verbot manifestieren sich darin, dass der Täter den vom Opfer ausdrücklich oder schlüssig geäußerten entgegenstehenden Willen bewusst übergeht (vgl. Wolters aaO). Das Tatbestandsmerkmal der Wiederholung ergibt sich aus einer Gesamtwürdigung der verschiedenen Handlungen, bei der insbesondere auch der zeitliche Abstand zwischen den Angriffen und deren innerer Zusammenhang von Bedeutung sind (BT-Drucks. 16/575 S. 7; Valerius aaO S. 322; kritisch Mosbacher aaO S. 666; Neubacher/Seher JZ 2007, 1029, 1032).
4. Was bedeutet „geeignet“ die Lebensgestaltung zu beeinträchtigen?
Die Tathandlung muss potentiell geeignet sein, die Lebensgestaltung des betroffenen Opfers nicht unerheblich zu beeinträchtigen. Eine tatsächliche Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. Die Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des / der Betroffenen muss aus Sicht eines objektiven Betroffenen / Jedermanns nicht unerheblich sein. Tathandlungen, die objektiv harmlos sind, sind tatbestandlich als Beeinträchtigung nicht geeignet, auch wenn der / die Betroffene aufgrund einer persönlichen oder psychischen Vorgeschichte extrem darauf reagiert.
5. Was bedeutet „nicht unerhebliche“ Beeinträchtigung der Lebensgestaltung?
Unter dem Tatbestandsmerkmal „nicht unerheblich“ fallen keine Bagatellangriffe. Eine „nicht unerhebliche“ Beeinträchtigung der körperlichen Integrität oder des körperlichen Wohlbefindens des Opfers voraussetzt. Hier wie dort müssen Sie die Eignung der Handlung bewerten. Dies geschieht anhand eines objektivierenden Maßstabs aus der Perspektive des Opfers. Wesentliche Wertungskriterien sind Häufigkeit, Kontinuität, Intensität und zeitlicher Zusammenhang.
6. Was ist eine Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des / der Betroffenen?
Die Tathandlung muss zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers führen. Der Begriff der Lebensgestaltung umfasst ganz allgemein die Freiheit der menschlichen Entschlüsse und Handlungen (BT-Drucks. 16/575 S. 7; Wolters aaO Rdn. 4). Sie wird beeinträchtigt, wenn das Opfer durch die Handlung des Täters veranlasst wird, ein Verhalten an den Tag zu legen, das es ohne Zutun des Täters nicht gezeigt hätte. Stets festzustellen ist demnach eine erzwungene Veränderung der Lebensumstände (BT-Drucks. 16/575 S. 8; Wolters aaO Rdn. 5). Dieses weite Tatbestandsmerkmal erfährt nach dem Wortlaut des Gesetzes eine Einschränkung dahin, dass die Beeinträchtigung nicht unerheblich sein muss. Erfasst werden damit im konkreten Kontext ins Gewicht fallende, erhebliche Folgen, die über durchschnittliche, regelmäßig hinzunehmende und zumutbare Modifikationen der Lebensgestaltung erheblich und objektivierbar hinausgehen. Nicht ausreichend sind daher weniger gewichtige Maßnahmen der Eigenvorsorge, wie beispielsweise die Benutzung eines Anrufbeantworters und die Einrichtung einer so genannten Fangschaltung zum Zwecke der Beweissicherung. Weitergehende Schutzvorkehrungen des Opfers, wie etwa das Verlassen der Wohnung nur noch in Begleitung Dritter, ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Wohnung und das Verdunkeln der Fenster der Wohnung, sind dagegen als erheblich und schwerwiegend anzusehen (BTDrucks. 16/575 S. 8; OLG Hamm aaO; Lackner/Kühl aaO Rdn. 2; Wolters aaO Rdn. 6). Danach schützt der Tatbestand weder Überängstliche noch besonders Hartgesottene, die sich durch das Nachstellen nicht beeindrucken lassen (vgl. Wolters aaO Rdn. 2; Mitsch aaO; Mosbacher aaO).
Das aus diesem Umstand ersichtlich werdende – geradezu typische – Verhältnis zwischen Tathandlung und Taterfolg im Rahmen des § 238 Abs. 1 StGB belegt zunächst, dass die mehreren Angriffe des Stalkers / Nachstellers nicht deshalb zur Tateinheit im materiellrechtlichen Sinn zusammengefasst werden können, weil sie Teile einer Dauerstraftat sind; denn § 238 Abs. 1 StGB stellt trotz insoweit mehrdeutiger Passagen in den Gesetzesmaterialien kein Dauerdelikt im rechtstechnischen Sinne dar (Gazeas aaO S. 503 f.; ders. KritJ 2006, 247, 261 ff.; Valerius aaO S. 323). Der Gesetzentwurf der Bundesregierung beschreibt einleitend das „Stalking“ als Verhaltensweise, die dadurch gekennzeichnet ist, dass einer anderen Person fortwährend nachgestellt, aufgelauert oder auf andere Weise mit hoher Intensität Kontakt zu ihr gesucht bzw. in ihren individuellen Lebensbereich eingegriffen wird (BT-Drucks. 16/575 S. 1). In dem vom Bundestag vorgeschlagenen Gesetzestext sowie der Begründung findet sich jedoch kein weitergehender Hinweis darauf, dass der Tatbestand als Dauerdelikt im rechtstechnischen Sinne ausgestaltet sein sollte. Nach dem Gesetzentwurf des Bundesrats sollte demgegenüber nur ein „fortgesetztes“ Handeln des Täters tatbestandsmäßig sein; nach der dortigen Begründung sollte damit der „Typik des 'Stalking' Rechnung getragen und der Charakter der Vorschrift als Dauerdelikt zum Ausdruck gebracht“ werden (BT-Drucks. 16/1030 S. 7). Die beiden Gesetzentwürfe zusammenführende Beschlussempfehlung und der Bericht des Rechtsausschusses, die Grundlage der später verabschiedeten Gesetzesfassung sind, verhalten sich nicht ausdrücklich zu dem Charakter der Vorschrift. Indes wurde der Gesetzentwurf des Bundesrats formal einstimmig abgelehnt und derjenige des Bundestags mit Modifizierungen an anderen Stellen angenommen. Das im Entwurf des Bundesrats enthaltene Merkmal eines „fortgesetzten“ Handelns des Täters wurde nicht in den endgültigen Gesetzestext aufgenommen. Diese Umstände weisen immerhin darauf hin, dass der Gesetzgeber im Ergebnis den Tatbestand nicht als Dauerdelikt ausgestalten wollte. Gegen die Annahme einer Dauerstraftat sprechen in der Sache der typische Charakter von „Stalking“-Angriffen sowie die Struktur des Tatbestands. Als Dauerdelikt sind nur solche Straftaten anzusehen, bei denen der Täter den von ihm in deliktischer Weise geschaffenen rechtswidrigen Zustand willentlich aufrecht erhält oder die deliktische Tätigkeit ununterbrochen fortsetzt, so dass sich der strafrechtliche Vorwurf sowohl auf die Herbeiführung als auch auf die Aufrechterhaltung des rechtswidrigen Zustands bezieht (BGHSt 42, 215, 216; Fischer aaO Vor § 52 Rdn. 58). „Stalking“-Angriffe zeichnen sich demgegenüber durch zeitlich getrennte, wiederholende Handlungen aus, die nicht zu einem gleich bleibenden und überbrückenden deliktischen Zustand führen (Gazeas JR 2007, 497, 504). Die Beeinträchtigung der persönlichen Lebensgestaltung des Opfers wird durch jede einzelne Handlung des Nachstellens erneuert und intensiviert (Valerius aaO S. 324). § 238 Abs. 1 StGB ist zudem als Erfolgsdelikt ausgestaltet, wobei die insoweit erforderliche schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers in der Regel nicht bereits durch den ersten Angriff des Täters, sondern erst durch sein beharrliches Handeln herbeigeführt wird. Solange der Tatbestand indes noch nicht vollständig verwirklicht worden ist, liegt noch kein in deliktischer Weise geschaffener rechtswidriger Zustand vor, den der Täter im Sinne der Begehung eines Dauerdelikts willentlich aufrechterhalten kann.
Die Tatbestandsstruktur des § 238 Abs. 1 StGB weist jedoch Elemente auf, die denen eines Dauerdelikts durchaus ähnlich sind. Die Vorschrift umfasst objektiv nach ihrem Wortlaut und ihrem durch Auslegung zu ermittelnden Sinn typischerweise ein über den Einzelfall hinausreichendes, auf gleichartige Wiederholung gerichtetes Verhalten und soll somit typischerweise ganze Handlungskomplexe treffen (BGHSt 43, 1, 4 zu § 99 StGB). Es liegt deshalb auf der Hand, in Fallgestaltungen wie der vorliegenden von einer sukzessiven Tatbegehung auszugehen (Gazeas KritJ 2006, 247, 262; ders. JR 2007, 504: iterative, d. h. wiederholte Tatbestandsverwirklichung), die eine ununterbrochene deliktische Tätigkeit oder einen in deliktischer Weise geschaffenen Zustand nicht voraussetzt (Rissing-van Saan in LK 12. Aufl. Vor § 52 Rdn. 24). Die sukzessive Tatbegehung ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass sich der Täter dem tatbestandlichen Erfolg nach und nach nähert: Dabei werden diejenigen einzelnen Handlungen des Täters, die erst in ihrer Gesamtheit zu der erforderlichen Beeinträchtigung des Opfers führen, unter rechtlichen Gesichtspunkten im Wege einer tatbestandlichen Handlungseinheit zu einer Tat im materiellen Sinne zusammengefasst, wenn sie einen ausreichenden räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufweisen und von einem fortbestehenden einheitlichen Willen des Täters getragen sind (Rissing-van Saan aaO Rdn. 36). Anders als bei der natürlichen Handlungseinheit ist dabei indes kein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang des strafbaren Verhaltens zu fordern. Vielmehr können zwischen den einzelnen tatbestandsausfüllenden Teilakten erhebliche Zeiträume liegen (BGHSt 43, 1, 3 zu § 99 StGB). Danach liegt hier nur eine Handlung im Rechtssinne vor. Die Angriffe des Angeklagten bewirkten erst in ihrer Gesamtheit den tatbestandlichen Erfolg im Sinne einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers. Sie waren von einer durchgehenden, einheitlichen Motivationslage des Angeklagten bestimmt und wiesen trotz der teilweise mehrwöchigen Unterbrechungen eine genügende räumliche und zeitliche Nähe auf.
Die Nachstellung nach § 238 Abs. 1 StGB verklammert die von dem Stalker / Nachsteller ebenfalls verwirklichten Delikte der Bedrohung und Beleidigung, so dass insgesamt Tateinheit gegeben ist (aA Valerius aaO S. 324). Zwischen an sich selbstständigen Delikten kann durch ein weiteres Delikt - auch einer anderen Handlungseinheit (Rissing-van Saan aaO § 52 Rdn. 28) - Tateinheit hergestellt werden, wenn dieses weitere Delikt - bzw. die Handlungseinheit - mit den anderen Straftatbeständen jeweils ideell konkurriert und zumindest mit einem der verbundenen Delikte eine annähernde Wertgleichheit besteht oder die verklammernde Tat die schwerste ist (Fischer aaO Vor § 52 Rdn. 30; Rissing-van Saan aaO Rdn. 30). Dies ist hier der Fall. Die Ausführungshandlungen der an sich getrennt verwirklichten Bedrohungen bzw. Beleidigungen sind zwar nicht miteinander, wohl aber mit den Ausführungshandlungen der Nachstellung (teil-)identisch. Die zu einer tatbestandlichen Handlungseinheit verbundenen einzelnen Teilakte der Nachstellung bilden deshalb jeweils mit den daneben verwirklichten Tatbeständen der Bedrohung und Beleidigung eine Tat im materiellrechtlichen Sinn. Die Nachstellung ist nach § 238 Abs. 1 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und damit mit höherer Strafe als die Bedrohung und die Beleidigung bedroht, deren Strafrahmen jeweils von Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe reicht. Sie stellt daher das schwerste der verwirklichten Delikte dar.
7.1. Nachstellen / Stalking durch Herstellung physischer Nähe zum Opfer
§ 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB soll physische Annäherungen an das Opfer wie das Auflauern, Verfolgen, vor dem Haus stehen und sonstige häufige Präsenz in der Nähe der Wohnung oder Arbeitsstelle des Opfers erfassen. Erforderlich ist ein gezieltes Aufsuchen oder gezielt herbeigeführte räumliche Nähe zum Opfer (BTDrucks. 16/575 S. 7; Lackner/Kühl, StGB, 26. Aufl. § 238 Rdn. 4; Wolters aaO Rdn. 10; Mitsch NJW 2007, 1237, 1238; Valerius aaO S. 321). § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB erfasst Nachstellungen durch unerwünschte Anrufe, E-Mails, SMS, Briefe, schriftliche Botschaften an der Windschutzscheibe oder Ähnliches und mittelbare Kontaktaufnahmen über Dritte (BTDrucks. 16/575 S. 7; Wolters aaO Rdn. 11; Mitsch aaO S. 1239).
Offen ist, ob der / die Betroffene die räumliche Nähe bemerkt haben muss, was teilweise unter Hinweis auf den Schutzzweck des § 238 bejaht wird. Nach anderer Auffassung soll es genügen, dass das Opfer auf andere Weise, z. B. durch Dritte, Nachbarn, erfährt, dass der Täter sich heimlich in seiner Nähe aufhält, da in diesem Fall die Handlung geeignet sein kann, die Lebensgestaltung zu beeinträchtigen.
7.2. Nachstellen / Stalking unter Verwendung von Kommunikationsmitteln oder über Dritte
Gemäß § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB macht sich strafbar, wer unter Verwendung von Kommunikationsmitteln oder über Dritte versucht, Kontakt zu dem Opfer herzustellen. Dazu zählen Anrufe, SMS, sonstige Mitteilungen über Mitteilungsplattformen wie Instagram, WhatsApp, Facebook, Signal, soziale Netzwerke, durch Bekannte überreichte Briefe.
7.3. Nachstellen / Stalking durch missbräuchliche Nutzung persönlicher Daten, Bestellungen oder Dienstleistungen.
§ 238 Abs. 1 Nr. 3 StGB erfasst die missbräuchliche Verwendung personenbezogener Daten zur Bestellung von Waren oder Dienstleistungen oder zur Herstellung eines Kontaktes. Abonnements von Zeitungen, telefonische oder Internetbestellungen von Gütern, Lebensmitteln unter dem Namen und an die Adresse des / der Betroffenen, Internetanzeigen sexueller Dienstleistungen unter der Telefonnummer des / der Betroffenen mit der Folge, dass interessierte Kunden den / die Betroffenen anrufen usw.
7.4. Nachstellen / Stalking durch Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit
Gemäß § 238 Abs. 1 Nr. 4 StGB macht sich strafbar, wer das Opfer, einen Angehörigen oder eine nahestehende Person in der dort genannten Weise mit einer Verletzung der höchstpersönlichen Rechtsgüter Leben, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit und (Fortbewegungs-)Freiheit bedroht. Wichtig ist, dass stets der/ die Betroffene bedroht wird, auch wenn dies durch die Drohung gegen einen Angehörigen oder eine nahestehende Person vermittelt wird. Es genügt, dass der Täter in Aussicht stellt, die Rechtsgüter Angehöriger oder nahestehender Personen zu verletzen. BeckOK StGB/Valerius § 238 Rn. 8.
7.5. Nachstellen / Stalking durch Cyberstalking, Ausspähen, Abfangen persönlicher Daten
Gemäß § 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB wird das zunehmende „Cyberstalking“ strafrechtlich erfasst. Das Ausspähen oder Abfangen von sensiblen persönlichen Daten und damit die Begehung einer Straftat gem. §§ 202a bis 202c zum Nachteil des Opfers, eines Angehörigen oder einer anderen nahestehenden Person etwa bei Erraten von Passwörtern, durch Hacking- oder durch eine sog. „Stalking Software“, Zugang zu Datenträgern oder zu sozialen Netzwerken wird unter Strafe gestellt.
7.6. Nachstellen / Stalking durch Abbildungen / Rachepornos
Gemäß § 238 Abs. 1 Nr. 6 StGB wird bestraft, wer Abbildungen des Opfers, eines Angehörigen oder einer anderen nahestehenden Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Bei Abbildungen sind Inhaltsdarstellungen gemäß § 11 Abs. 3 StGB. Darüber hinaus werden digitale Darstellungen, Bild- und Videoaufnahmen erfasst. In welcher Situation der / die Betroffene abgebildet wird, ist unerheblich. Das Hochladen und Verbreiten eines „Rachepornos“, gleichfalls auch gemäß § 184 StGB strafbar, wird wie das Verbreiten eines mehrfach kopierten Liebesbriefes unter Strafe gestellt.
7.7. Nachstellen / Stalking durch Urhebertäuschung durch Fakeaccounts des Opfers
§ 238 Abs. 1 Nr. 7 StGB stellt das Verbreiten bzw. öffentliche Zugänglichmachen von Inhalten i. S. d § 11 Abs. 3 StGB unter Vortäuschen der Urheberschaft / dem Vortäuschen der Identität des Opfers unter Strafe, wenn diese geeignet sind, das Opfer verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Der Täter legt unter dem Namen des Opfers und mit Fotos von diesem einen Hate- oder Sex-Account, z. B. bei Tinder, an und tauscht angebliche Gewalt- oder Sexualphantasien mit anderen Nutzern aus.
7.8. Nachstellen / Stalking durch vergleichbare Handlungen (Auffangtatbestand)
§ 238 Abs. 1 Nr. 8 StGB ist eine Auffangregelung, mit der alle anderen mit den § 238 Abs. 1 Nr. 1 – 7 StGB vergleichbaren Handlungen unter Strafe gestellt werden. Darunter fallen
diskreditierende Handlungen, die das Opfer im persönlichen und beruflichen Umfeld durch nicht gemäß § 238 Abs. 1 Nr. 1 - 7 StGB aufgelistete Verhaltensweisen, welche die Veröffentlichung von persönlichen Daten des Opfers im Internet, die permanente anonyme Zusendung von Geschenken, Drohen mit der Verbreitung einer Abbildung, ferner sexuelle Belästigungen oder tätliche Angriffe umfassen.
8. Besonders schwere Fälle der Nachstellung / Stalkings
In besonders schweren Fällen des § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 StGB wird die Nachstellung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1.
durch die Tat eine nicht unerhebliche Gesundheitsschädigung des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person verursacht,
2.
das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch die Tat in die konkrete Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt,
3.
dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nachstellt,
4.
bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 ein Computerprogramm (Stalkingsoftware) einsetzt, dessen Zweck das digitale Ausspähen anderer Personen ist,
5.
eine durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangte Abbildung bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 6 verwendet,
6.
einen durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangten Inhalt (§ 11 Absatz 3) bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 7 verwendet oder
7.
über einundzwanzig Jahre ist und das Opfer unter sechzehn Jahre ist.
9. Tod durch Nachstellen / Stalking
Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Dabei genügt es, dass der Tod des Opfers fahrlässig verursacht wurde.
10. Reform des Stalking- / Nachstellungstatbestands
Mit der Neufassung des § 238 StGB wurde aus dem bisherigen konkreten Erfolgsdelikt ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Demnach muss keine tatsächliche Beeinträchtigung des Opfers mehr eingetreten sein. Vielmehr kann bereits eine Handlung eine Stalking-Handlung / Nachstellung sein, wenn diese geeignet ist, den Tatbestandserfolg hervorzurufen.
§ 238 StGB soll dem technischen Fortschritt und der damit einhergehenden Zunahme des Cyberstalkings gerecht werden. Über sogenannte Stalking-Apps beziehungsweise Stalkingsoftware können Täter ohne vertiefte IT-Kenntnisse unbefugt auf E-Mail- oder Social-Media-Konten sowie Bewegungsdaten von Opfern zugreifen und so deren Sozialleben ausspähen. Cyberstalking erfolgt aber nicht nur durch den unbefugten Zugriff auf Daten des Opfers, sondern insbesondere auch dadurch, dass der Täter unter Vortäuschung der Identität eines Opfers, etwa in den sozialen Medien-Konten anlegt und unter dem Namen des Opfers abträgliche Erklärungen abgibt oder bloßstellende Abbildungen des Opfers, z. B. Fotomontage auf Pornoabbildungen, veröffentlicht. Diese besonderen Begehungsweisen von Nachstellungstaten gilt es gesetzlich besser und rechtssicherer zu erfassen.
Ferner ist der Tatbestand des Stalkings / Nachstellung kein Privatklagedelikt mehr, sondern ein Offizialdelikt. Die Staatsanwaltschaft verfolgt daher das Delikt von Amts wegen.
11. Welche Strafe droht bei einer Verurteilung wegen Nachstellens / strafbaren Stalkings?
Stalking / Nachstellung kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden. Die Strafe bemisst sich nach dem konkreten Einzelfall. In besonders schweren Fällen ist ein erhöhter Strafrahmen eröffnet. Wird das Opfer oder eine dem Opfer nahe stehende Person in die Gefahr des Todes gebracht, droht in diesem Fall eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Wird der Tod des Opfers verursacht, beträgt die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
12. Sie können ohne Strafverteidiger / Fachanwalt für Strafrecht gegen den Vorwurf des Stalkings / der Nachstellung nicht bestehen
Der Vorwurf des Stalkings / Nachstellung wird häufig nach einer gescheiterten Beziehung erhoben. Der Ex-Partner möchte mit Mitteln des Strafrechts den anderen nachträglich schädigen, sich rächen und im Einzelfall jede Kontaktaufnahme, die sozial adäquat und rechtlich nicht zu beanstanden ist, unterbinden und kriminalisieren. Gelegentlich wird der Vorwurf der Nachstellung / des Stalkings vor dem Hintergrund erhoben, sich einen Vorteil in einem Sorgerechtsstreit zu verschaffen, wenn nicht rechtsmissbräuchlich der Vorwurf des Kindesmissbrauchs erhoben wird.
Häufig erfüllt der angezeigte Sachverhalt den Tatbestand nicht, weil die Kontaktaufnahme noch sozial adäquat war, und die unerwünschte, belästigende Kontaktaufnahme nicht beharrlich oder einschneidend bzw. gravierend war. Die Kontaktaufnahme muss geeignet sein, eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung zu bewirken. Eine bloße Belästigung oder Bedrohung, die gemäß § 241 StGB strafbar ist, genügt dem Tatbestand der Nachstellung / des strafbaren Stalking nicht. Vielmehr muss tatsächlich und objektiv die Lebensgestaltung des Betroffenen / „Gestalkten“ unfreiwillig verändert worden sein.
Ob diese Anforderungen erfüllt sind, kann nur durch Prüfung im Einzelfall durch unsere Fachanwälte für Strafrecht, Rechtsanwälte Lauenburg Kopietz, Herzog, Hoffmann belastbar prognostiziert respektive festgestellt werden. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, bereits frühzeitig im Ermittlungsverfahren durch einen Fachanwalt für Strafrecht eine Einstellung des Verfahrens zu erwirken, damit eine Anklage und eine belastende Hauptverhandlung sowie eine etwaige Verurteilung vermieden werden.
Neben dem Tatbestand der Nachstellung können auch andere Tatbestände wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, sexuelle Nötigung, vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung sowie Bedrohung erfüllt sein.
13. Untersuchungshaft zur Gefahrenabwehr
Nach der Strafprozessordnung können besonders gefährliche Täter in Haft genommen werden, um vorhersehbaren schwersten Straftaten gegen Leib und Leben vorzubeugen.
Bisher war die Anordnung der Untersuchungshaft erst dann möglich, wenn bereits schwerwiegende Verletzungshandlungen verwirklicht wurden. Nunmehr kann bereits Haft vollzogen werden, wenn eine konkrete Gefahr eingetreten ist.
14. Was Betroffene tun können
1. Strafrecht: Personen, die sich durch Nachstellung wiederholt und nicht unerheblich belästigt und in ihrer Lebensführung einschneidend eingeschränkt fühlen, können Strafanzeige gemäß § 238 StGB (Strafgesetzbuch) bei der Polizei erstatten.
2. Zivilrecht: Gemäß dem Gewaltschutzgesetz kann bei Gericht eine einstweilige Verfügung oder Gewaltschutzanordnung erwirkt werden, die dem Nachsteller / Stalker jegliche persönliche Kontaktaufnahme auch über elektronische Medien verbietet und ein Näherungsverbot oder Abstandsgebot für die Person und die Wohnung ausspricht. Bei Verstoß gegen die einstweilige Verfügung oder Gewaltschutzanordnung kann das Gericht ein Ordnungsgeld bis € 250.000,00 oder ersatzweise Ordnungshaft, bzw. bei der Gewaltschutzanordnung zusätzlich eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr aussprechen.
StGB § 238 Tatbestand Nachstellung (strafbares Stalking)
LAUENBURG | KOPIETZ | HERZOG | HOFFMANN
Rechtsanwälte Strafverteidigung