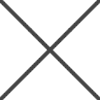NEWS ARCHIV
Mandantenbriefe
Beschluss vom 07. Dezember 2022, 2 BvR 1404/20
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen ein Strafurteil des Landgerichts Berlin vom 26. März 2019 und ein Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs vom 18. Juni 2020 richtete. Der Beschwerdeführer verursachte Anfang des Jahres 2016 bei einem Autorennen auf dem Berliner Kurfürstendamm einen Autounfall, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Das Landgericht verurteilte ihn deswegen unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, der Bundesgerichtshof verwarf seine Revision. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer nicht in seinen verfassungsmäßig garantierten Rechten. Die Fachgerichte haben mit der Annahme, der Beschwerdeführer habe mit Tötungsvorsatz gehandelt, das Bestimmtheitsgebot nicht missachtet. Ein Verstoß gegen das Schuldprinzip ist ebenfalls nicht dargetan.
Sachverhalt:
Anfang des Jahres 2016 befuhr der Beschwerdeführer mit seinem hochmotorisierten Kraftfahrzeug den Berliner Kurfürstendamm. Dort vereinbarte er mit dem Mitangeklagten des Ausgangsverfahrens, ein Wettrennen bis zur nächsten roten Ampel – ein in der Raser-Szene so genanntes Stechen – auszutragen. In der Folge entwickelte sich eine Wettfahrt durch die Berliner Innenstadt, bei der der Beschwerdeführer mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln überfuhr und schließlich mit kontinuierlich voll durchgetretenem Gaspedal und einer Geschwindigkeit von wenigstens 160 km/h mit einem bei Grünlicht in eine Kreuzung einfahrenden Geländewagen zusammenstieß. Der Geländewagen drehte sich um die eigene Achse, flog etwa 25 Meter weit durch die Luft, schlug mit dem Dach auf der Fahrbahn auf, rutschte auf der Seite liegend die Fahrbahn entlang und blieb 72 Meter vom Kollisionsort entfernt liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.
Mit angegriffenem Urteil verurteilte das Landgericht den Beschwerdeführer unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Kammer zeigte sich davon überzeugt, dass der Beschwerdeführer mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt habe. Die dagegen eingelegte Revision des Beschwerdeführers war – abgesehen von einer geringfügigen Änderung des Schuldspruchs – erfolglos. Der Bundesgerichtshof betonte in seiner Entscheidung, die Beweiswürdigung des Landgerichts zur Frage einer bedingt vorsätzlichen Tötung sei revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das Landgericht habe die maßgeblichen vorsatzrelevanten objektiven Tatumstände gesamtwürdigend betrachtet und sich mit den im konkreten Fall wesentlichen vorsatzkritischen Umständen hinreichend auseinandergesetzt.
Mit seiner Verfassungsbeschwerde wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Urteile des Landgerichts und des Bundesgerichtshofs. Er rügt eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots und des Schuldgrundsatzes durch die Auslegung des Vorsatzbegriffs und die Beweiswürdigung zum Tatvorsatz.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, weil die Annahmevoraussetzungen des § 93a Abs. 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) nicht erfüllt sind.
1. Einen Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz (GG) zeigt der Beschwerdeführer nicht auf.
a) Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Die Vorschrift enthält für die Gesetzgebung ein striktes Bestimmtheitsgebot sowie ein damit korrespondierendes, an die Rechtsprechung gerichtetes Verbot strafbegründender Analogie.
Aus der Zielsetzung des Art. 103 Abs. 2 GG sind für die Gerichte Vorgaben für die Handhabung weit gefasster Tatbestände und Tatbestandselemente zu entnehmen. Sie dürfen nicht durch eine fernliegende Interpretation oder ein Normverständnis, das keine klaren Konturen mehr erkennen lässt, dazu beitragen, bestehende Unsicherheiten über den Anwendungsbereich einer Norm zu erhöhen. Andererseits ist die Rechtsprechung gehalten, verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen (sogenanntes Präzisierungsgebot).
b) Gemessen an diesen Maßstäben haben die Fachgerichte mit der Annahme, der Beschwerdeführer habe mit Tötungsvorsatz gehandelt, die Vorgaben des Bestimmtheitsgebots nicht missachtet.
aa) Die Rüge, die Fachgerichte hätten eine dem Bestimmtheitsgebot widersprechende Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit vorgenommen, dringt nicht durch. Unschädlich ist, dass das Strafgesetzbuch diese Begriffe ohne die Rechtsanwendung anleitende Definitionen verwendet. Art. 103 Abs. 2 GG schließt die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln im Strafrecht nicht aus, wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung derartiger Begriffe gewinnen lässt.
Jedenfalls bei Tötungsdelikten besteht für die Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit eine solche gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung. Danach ist bedingter Tötungsvorsatz gegeben, wenn der Täter den Tod als mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns erkennt (Wissenselement) und dies billigt oder sich um des erstrebten Zieles willen zumindest mit dem Eintritt des Todes abfindet, mag ihm der Erfolgseintritt auch gleichgültig oder an sich unerwünscht sein (Willenselement). Bewusste Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, wenn der Täter ernsthaft und nicht nur vage darauf vertraut, der tatbestandliche Erfolg werde nicht eintreten. Bei der Annahme bedingten Vorsatzes müssen beide Elemente der inneren Tatseite, also sowohl das Wissenselement als auch das Willenselement, in jedem Einzelfall anhand einer Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände geprüft und durch tatsächliche Feststellungen belegt werden. Die objektive Gefährlichkeit einer Handlung und der Grad der Wahrscheinlichkeit eines Erfolgseintritts sind dabei maßgebliche, jedoch nicht alleinige Kriterien für die Entscheidung, ob ein Angeklagter mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat.
Es ist weder dargetan noch aus sich heraus ersichtlich, dass diese den Vorsatzbegriff konkretisierende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit Art. 103 Abs. 2 GG unvereinbar ist. Zwar ist diese Rechtsprechung Kritik unterworfen, die im Ergebnis jedoch nur aufzeigt, dass – auch vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgebots zulässige – Randunschärfen bei der Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit bestehen. Damit umzugehen, obliegt der fachgerichtlichen Rechtsprechung und der Strafrechtswissenschaft und berührt die Gewährleistungen des Bestimmtheitsgebots nicht. Es ist auch bei der Rüge eines Verstoßes gegen Art. 103 Abs. 2 GG nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, seine Auffassung von der zutreffenden oder überzeugenderen Auslegung des einfachen Rechts an die Stelle derjenigen der Fachgerichte zu setzen.
bb) Die angegriffenen Entscheidungen fügen sich in diese – dem aus Art. 103 Abs. 2 GG abgeleiteten Präzisierungsgebot entsprechende – ständige Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit ein und lassen damit den behaupteten Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot nicht erkennen. Ausdrücklich nehmen beide Entscheidungen diese ständige Rechtsprechung zum Ausgangspunkt ihrer weiteren Prüfung. Dementsprechend haben sowohl das Landgericht als auch der Bundesgerichtshof nicht nur auf die objektive Gefährlichkeit der Handlung abgestellt, sondern auf die wesentlichen festgestellten Umstände des Einzelfalls, die Rückschlüsse auf das Wissens- und das Willenselement der inneren Tatseite zulassen.
cc) Der Beschwerdevortrag ist jedenfalls nicht geeignet, die Auslegung des Vorsatzbegriffs und die Subsumtion des festgestellten Sachverhalts darunter vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgebots verfassungsrechtlich in Zweifel zu ziehen. Im Ergebnis zielt er auf den Wunsch nach einer verfassungsgerichtlichen Neubewertung des festgestellten Sachverhalts anhand des einfachen Rechts ab. Damit legt der Beschwerdeführer den falschen Maßstab an, denn Art. 103 Abs. 2 GG berührt die Zuständigkeit der Fachgerichte für die Auslegung und Anwendung des Strafrechts innerhalb des Wortsinns der Straftatbestände nicht. Soweit der Beschwerdeführer einen Verstoß gegen das Verschleifungsverbot geltend macht, verkennt er, dass es nicht zu einer unzulässigen Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen führt, wenn einem tatsächlichen Umstand – wie hier der objektiven Gefährlichkeit der Tathandlung als wesentlicher Indikator sowohl für das Wissens- als auch das Willenselement – Beweisbedeutung für unterschiedliche Tatbestandsmerkmale zugemessen wird.
2. Einen Verstoß gegen das Schuldprinzip hat der Beschwerdeführer ebenfalls nicht dargetan.
a) Das Strafrecht beruht auf dem im Verfassungsrang stehenden Schuldgrundsatz. Dieser den gesamten Bereich staatlichen Strafens beherrschende Grundsatz ist in der Garantie der Würde und Eigenverantwortlichkeit des Menschen sowie im Rechtsstaatsprinzip verankert. Für den Bereich des Strafrechts werden diese rechtsstaatlichen Anliegen in dem Grundsatz aufgenommen, dass keine Strafe ohne Schuld verwirkt wird. Gemessen an der Idee der Gerechtigkeit müssen auch Straftatbestand und Rechtsfolge sachgerecht aufeinander abgestimmt sein. Die Strafe muss in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters stehen, hat mithin die Bestimmung, gerechter Schuldausgleich zu sein.
b) Der Beschwerdeführer zeigt eine sich an diesen Maßstäben orientierende Verletzung des Schuldgrundsatzes durch die Annahme eines Tötungsvorsatzes nicht auf.
aa) Die Rechtsprechung zur Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit begegnet auch im Hinblick auf das Schuldprinzip keinen Bedenken, weil die individuelle Vorwerfbarkeit Grundlage für die Bestimmung des Schuldgehalts und des Strafrahmens ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat das Tatgericht bei der Prüfung des voluntativen Elements des bedingten Vorsatzes alle objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Persönlichkeit des Täters, dessen psychische Verfassung bei der Tatbegehung und dessen Motivlage, in Betracht zu ziehen.
bb) Da sich die angegriffenen Entscheidungen in diese ständige Rechtsprechung einfügen, ist ein Verstoß gegen den Schuldgrundsatz nicht erkennbar. Jedenfalls ist der Beschwerdevortrag nicht geeignet, die Urteile von Landgericht und Bundesgerichtshof im Hinblick auf das Schuldprinzip verfassungsrechtlich in Zweifel zu ziehen.
(1) Im Wesentlichen zielt die Argumentation des Beschwerdeführers darauf ab, das Landgericht habe – vom Bundesgerichtshof unbeanstandet – bei der Bejahung des Tötungsvorsatzes und der Einordnung der Tat als Mord nicht die Umstände des Einzelfalls zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht, sondern nach dem Leitbild eines rational Handelnden von der objektiven Gefährlichkeit der Wettfahrt auf den Tötungsvorsatz geschlossen. Das ist unzutreffend, da das Landgericht bei der Beweiswürdigung nicht nur auf die konkrete Gefährlichkeit der Fahrt abgestellt, sondern die Persönlichkeit des Beschwerdeführers, seine Motivation für das maximale Beschleunigen nach der Kurvenausfahrt, seine grundsätzliche Einstellung zum Autofahren und seine Einschätzung des eigenen fahrerischen Könnens im Blick gehabt hat. Das Landgericht ist damit dem verfassungsrechtlichen Gebot gerecht geworden, den Schuldspruch auf Feststellungen zur individuellen Vorwerfbarkeit der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Tat zu stützen.
Soweit der Beschwerdevortrag im Ergebnis darauf abzielt, dass es nähergelegen hätte, keinen Tötungsvorsatz anzunehmen, setzt der Beschwerdeführer damit lediglich seine eigene Würdigung der festgestellten Beweistatsachen an die Stelle der Würdigung des Schwurgerichts. Einen Verfassungsverstoß kann er damit nicht tragfähig begründen.
(2) Die Rüge, die Einordnung der Tat als Mord führe zu einem Verstoß gegen das Gebot schuldangemessenen Strafens, dringt ebenfalls nicht durch. Der Beschwerdeführer stellt auf fiktive Vergleichsfälle ab, um zu belegen, dass die lebenslange Freiheitsstrafe in sogenannten Raser-Fällen generell und speziell in seinem Fall nicht schuldangemessen sei. Die Argumentation beachtet den für die Bestimmung der Strafhöhe geltenden Maßstab der individuellen Schuld eines eigenverantwortlich handelnden Täters nicht, denn die auf die individuelle Schuld eines Täters gestützte Strafe entzieht sich grundsätzlich eines Vergleichs mit gegen andere Personen oder in anderem Zusammenhang verhängten Strafen.
Beschluss vom 09. Februar 2022, 2 BvL 1/20
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts § 315d Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuches (StGB), der sogenannte Einzelrennen unter Strafe stellt, für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.
Nach Auffassung des vorlegenden Amtsgerichts verstößt die Norm gegen den in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgrundsatz. Der Zweite Senat hat nun entschieden, dass der Gesetzgeber den Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB hinreichend konkretisiert und so dem aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz folgenden Bestimmtheitsgebot Genüge getan hat. Insbesondere das subjektive Tatbestandsmerkmal „um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“ ist einer methodengerechten Auslegung durch die Fachgerichte zugänglich.
Sachverhalt:
Gemäß § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich im Straßenverkehr als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Dem Angeschuldigten des Ausgangsverfahrens wird unter anderem eine Straftat nach § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB zur Last gelegt. Angeklagt war im Wesentlichen eine drei bis vier Minuten andauernde Polizeifluchtfahrt des Angeschuldigten, bei der er – teils innerhalb geschlossener Ortschaften – Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h erreicht, dabei nacheinander insgesamt vier Lichtzeichenanlagen überfahren haben und mit einem Verkehrsteiler kollidiert sein soll. Während der Verfolgungsfahrt sei es dem Angeschuldigten durchgehend darauf angekommen, unter Berücksichtigung der Verkehrslage und der Motorisierung seines Fahrzeugs möglichst schnell zu fahren, um auf diese Weise die ihn verfolgenden Polizeibeamten abzuschütteln.
Das Amtsgericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die Vorschrift des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB verfassungsgemäß ist. Nach seiner Auffassung verstößt die Norm gegen den in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgrundsatz.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
§ 315d Abs.1 Nr. 3 StGB ist mit dem Grundgesetz vereinbar.
I. Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Für den Gesetzgeber enthält Art. 103 Abs. 2 GG in seiner Funktion als Bestimmtheitsgebot die Verpflichtung, wesentliche Fragen der Strafwürdigkeit oder Straffreiheit im demokratisch-parlamentarischen Willensbildungsprozess zu klären und die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen. Das Bestimmtheitsgebot verlangt daher, den Wortlaut von Strafnormen so zu fassen, dass die Normadressaten im Regelfall bereits anhand des Wortlauts der gesetzlichen Vorschrift voraussehen können, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht.
II. Für die Strafgerichte konkretisiert der Satz „nulla poena sine lege“ den Grundsatz der Gewaltenteilung aus Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG. Sie dürfen nicht korrigierend in die Entscheidung des Gesetzgebers über die Strafbarkeit eingreifen. Sie sind allerdings gehalten, weit gefassten Tatbeständen innerhalb der Wortlautgrenze durch eine präzisierende Auslegung Konturen zu geben. Dabei sind die Strafgerichte verpflichtet, die einzelnen Tatbestandsmerkmale nicht so zu definieren, dass die vom Gesetzgeber dadurch bewirkte Eingrenzung der Strafbarkeit im Ergebnis wieder aufgehoben wird. Einzelne Tatbestandsmerkmale dürfen innerhalb ihres möglichen Wortsinns nicht so weit ausgelegt werden, dass sie vollständig in anderen Tatbestandsmerkmalen aufgehen, also zwangsläufig mit diesen mitverwirklicht werden (Verbot der Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen).
III. Eine Pflicht auch des Strafgesetzgebers, Tatbestandsmerkmale so zu formulieren, dass keines in einem anderen aufgeht, enthält Art. 103 Abs. 2 GG hingegen nicht. Angesichts seines aus dem Demokratieprinzip folgenden Einschätzungs- und Ermessensspielraums kann es dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, ihm zur Klarstellung wichtige, wenn auch ineinander aufgehende und damit im Ergebnis „verschleifende“ Tatbestandsmerkmale ausdrücklich in den Gesetzestext aufzunehmen. Um die Anforderungen des Bestimmtheitsgebots zu erfüllen, genügt es, dass der Gesetzgeber die Strafnormen so fasst, dass sich für den Normadressaten nach allgemeinen Maßstäben Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände erkennen und durch Auslegung ermitteln lassen.
IV. Nach diesen Maßstäben ist § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB mit dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG zu vereinbaren.
1. § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB lässt die erfassten Rechtsgüter der Sicherheit des Straßenverkehrs, des Lebens, der körperlichen Integrität und des Eigentums ebenso deutlich werden wie die besonderen Gefahren, vor denen der Gesetzgeber sie schützen will.
a) Die Tatbestandsmerkmale „grob verkehrswidrig“ und „rücksichtslos“, welche im Straßenverkehrsstrafrecht bereits bestehende Begriffe aufnehmen, sind durch die Judikatur hinreichend präzisiert.
b) Für das Tatbestandsmerkmal des Fortbewegens mit nicht angepasster Geschwindigkeit kann dem Wortlaut des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB der Bezugspunkt zur Bestimmung der nicht angepassten Geschwindigkeit zwar nicht unmittelbar entnommen werden. Dieser ergibt sich aber aus dem Regelungsgehalt der Vorschrift und der Gesetzesbegründung.
c) Hinsichtlich des Bezugspunkts der Tatbestandsmerkmale der groben Verkehrswidrigkeit und Rücksichtslosigkeit bestehen hinreichende Anknüpfungspunkte für eine methodengerechte Auslegung. Insbesondere kann der ausdrückliche Verweis in den Gesetzesmaterialien auf § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB – der ebenfalls als Bezugspunkt einen in der Norm aufgeführten Verkehrsverstoß voraussetzt – zur Auslegung herangezogen werden.
d) Auch der vom Gesetzgeber neu eingeführte Begriff der „höchstmöglichen Geschwindigkeit“ kann im Rahmen seines Wortsinns methodengerecht ausgelegt werden. Zur Bestimmung der Parameter, nach welchen sich die „höchstmögliche Geschwindigkeit“ bemisst, können die Gesetzesmaterialien herangezogen werden, welche ausdrücklich auf die Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnisse verweisen. Ferner lässt die Formulierung des Absichtsmerkmals eine Auslegung zu, nach der es nicht darauf ankommt, ob sich der Täter allein mit der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, fortbewegt oder noch weitergehende Beweggründe – wie beispielsweise die Flucht vor der Polizei oder den Wunsch nach öffentlicher Anerkennung durch späteres Einstellen eines Videos ins Internet – verfolgt.
2. Soweit das Absichtsmerkmal mit Blick auf die Abgrenzung zu noch straffreiem, allerdings womöglich nicht umfassend normkonformem oder rücksichtsvollem Verhalten im Straßenverkehr verbleibende Randunschärfen enthält, ist es einer Präzisierung durch die Rechtsprechung innerhalb des Wortsinns zugänglich. Die vom Bundesgerichtshof vorgenommene Interpretation des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB ist eine mögliche und methodengerechte Auslegung der Strafnorm. Wenn dieser davon ausgeht, dass sich die Zielsetzung des Täters nach seinen Vorstellungen auf eine unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten nicht ganz unerhebliche Wegstrecke beziehen müsse und sich nicht nur in der Bewältigung eines räumlich eng umgrenzten Verkehrsvorgangs erschöpfen dürfe, hält er sich im Rahmen der Wortlautgrenze des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und stellt methodengerecht auf die objektive Gefahrenlage ab. Er nimmt Verhaltensweisen im Straßenverkehr von der Strafbarkeit aus, die nach den Vorstellungen des Täters zwar auf das Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit zielen, sich aber subjektiv nur auf eine unter Verkehrssicherh
Beschluss vom 11. Januar 2022, 1 BvR 123/21
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass das Landgericht Berlin die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichem Recht auf prozessuale Waffengleichheit gemäß Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz verletzt hat, indem es ohne vorherige Anhörung eine einstweilige Verfügung erlassen hat.
Das zugrundeliegende Verfahren betrifft die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen. Das Landgericht hatte im Ausgangsverfahren ohne vorherige Anhörung der Beschwerdeführerin in einer äußerungsrechtlichen Sache eine einstweilige Verfügung erlassen. Vor deren Erlass waren mehrere gerichtliche Hinweise an die Antragstellerin des Ausgangsverfahrens ergangen, infolge derer sie ihren Vortrag ergänzte und die Anträge teilweise zurückgenommen hatte, ohne dass die Beschwerdeführerin hiervon Kenntnis hatte oder ihr Gelegenheit zur Stellungnahme gewährt worden wäre. Dies verletzt die Beschwerdeführerin offenkundig in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit. Den wiederholten Verstoß der Fachgerichte gegen das Gebot der Waffengleichheit bei einstweiligen Anordnungen nahm die Kammer im Anschluss an den Beschluss vom 1. Dezember 2021 - 1 BvR 2708/19 - (Pressemitteilung Nr. 11/2022 vom 11. Februar 2022) erneut zum Anlass, auf die rechtliche Bindungswirkung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hinzuweisen.
Sachverhalt:
Gegenstand des zugrundeliegenden Verfahrens war die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen. Im September 2020 berichtete die Beschwerdeführerin – ein Presseverlag – in Wort und Bild über die Feier eines Richtfestes für das im Bau befindliche Anwesen der prominenten Antragstellerin des Ausgangsverfahrens (im Folgenden: die Antragstellerin). Auf mehreren Fotos waren neben der Antragstellerin und ihrem Lebensgefährten der Rohbau des Hauses und die Gäste bei der Feierlichkeit zu sehen. Die Berichterstattung befasste sich unter anderem kritisch mit der Art und Weise der Durchführung der Feier während der aktuellen Corona-Pandemie.
Die Antragstellerin mahnte die Beschwerdeführerin hinsichtlich bestimmter Teile der Wortberichterstattung sowie der gesamten Bildberichterstattung ab und forderte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beschwerdeführerin wies die geltend gemachten Ansprüche zurück. Im Oktober 2020 stellte die Antragstellerin beim Landgericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Die Pressekammer des Landgerichts erteilte einen gerichtlichen Hinweis, worin sie Bedenken äußerte, allein der Antragstellerin und gewährte nur ihr Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Erwiderung der Antragstellerin erging erneut ein allein an sie gerichteter Hinweis des Gerichts, worauf hin die Antragstellerin den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung teilweise zurücknahm. Das Landgericht erließ anschließend „wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung“ die angegriffene einstweilige Verfügung, die der Beschwerdeführerin Teile der Wort- und Bildberichterstattung untersagte. Die einstweilige Verfügung wurde der Beschwerdeführerin am 7. Dezember 2020 zugestellt.
Am 8. Dezember 2020 baten die Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin das Landgericht um Übersendung etwaiger gerichtlicher Schreiben oder Aktennotizen in der vorliegenden Sache. Die Unterlagen gingen erst am 5. Januar 2021 bei den Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin ein.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf prozessuale Waffengleichheit sowie ihrer Rechte aus Art. 5 Abs. 1 GG.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Der Erlass der einstweiligen Verfügung durch das Landgericht hat die Beschwerdeführerin in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit aus Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG verletzt.
1. Die prozessuale Waffengleichheit steht im Zusammenhang mit dem Gehörsgrundsatz aus Art. 103 Abs. 1 GG, der eine besondere Ausprägung der Waffengleichheit ist. Als prozessuales Urrecht gebietet dieser, in einem gerichtlichen Verfahren der Gegenseite grundsätzlich vor einer Entscheidung Gehör und damit die Gelegenheit zu gewähren, auf eine bevorstehende gerichtliche Entscheidung Einfluss zu nehmen. Entbehrlich ist eine vorherige Anhörung nur in Ausnahmefällen. Eine stattgebende Entscheidung über den Verfügungsantrag kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Gegenseite die Möglichkeit hatte, auf das mit dem Antrag und weiteren an das Gericht gerichteten Schriftsätzen geltend gemachte Vorbringen zu erwidern. Gehör ist insbesondere auch zu gewähren, wenn das Gericht dem Antragsteller Hinweise nach § 139 ZPO erteilt, von denen die Gegenseite sonst nicht oder erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung erfährt. Ein einseitiges Geheimverfahren über einen mehrwöchigen Zeitraum, in dem sich Gericht und Antragsteller über Rechtsfragen austauschen, ohne den Antragsgegner in irgendeiner Form einzubeziehen, ist mit den Verfahrensgrundsätzen des Grundgesetzes unvereinbar.
2. Nach diesen Maßstäben verletzt der angegriffene Beschluss die Beschwerdeführerin offenkundig in ihrem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleichheit.
Durch Erlass der einstweiligen Verfügung ohne jegliche Einbeziehung der Beschwerdeführerin war vorliegend keine Gleichwertigkeit ihrer prozessualen Stellung gegenüber der Verfahrensgegnerin gewährleistet. Das Landgericht äußerte sich im Rahmen seiner schriftlichen Hinweise allein gegenüber der Antragstellerin zu seiner vorläufigen Rechtsauffassung in der Sache. Die Antragstellerin hatte daraufhin Gelegenheit Stellung zu nehmen, ergänzte ihren Vortrag und nahm ihren Antrag auf den zweiten richterlichen Hinweis hin teilweise zurück. Die Beschwerdeführerin hingegen erfuhr erst nach Erlass der sie belastenden einstweiligen Verfügung, dass ein Verfahren anhängig war und dass das Gericht Hinweise erteilt hatte. Auch eine Gelegenheit, sich zum weiteren Vorbringen der Antragstellerin zu äußern, wurde ihr nicht gegeben. Erschwerend kommt hinzu, dass das Landgericht der Beschwerdeführerin erst nach mehrmaliger Nachfrage und zudem acht Wochen nach Erlass der gegen sie gerichteten einstweiligen Verfügung die gerichtlichen Hinweise zukommen ließ, so dass der Beschwerdeführerin erst ab diesem Zeitpunkt das gesamte Prozessgeschehen bekannt war. Vorliegend wäre die Einbeziehung der Beschwerdeführerin durch das Gericht vor Erlass der Verfügung offensichtlich geboten gewesen.
Beschluss vom 09. Februar 2022, 2 BvR 1368/16, 2 BvE 3/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvR 1444/16
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mehrere Verfassungsbeschwerden und einen Antrag im Organstreitverfahren zur vorläufigen Anwendung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Kanada andererseits (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) als unbegründet zurückgewiesen. Soweit sich die Verfassungsbeschwerden und die Organklage darüber hinaus gegen die Unterzeichnung und den Abschluss von CETA wandten, hat der Senat sie als unzulässig verworfen.
Der Beschluss des Rates der Europäischen Union über die vorläufige Anwendung von CETA vom 28. Oktober 2016 ist weder als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren, noch werden dadurch die Grund-sätze des Demokratieprinzips im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und 2 GG berührt. Soweit die Vertragsschlusskompetenz der Europäischen Union für einzelne Bereiche umstritten ist, ist die vorläufige Anwendung beschränkt. Dies gilt auch insoweit, als mit CETA möglicherweise Hoheitsrechte auf das Gerichts- und das Ausschusssystem weiterübertragen werden. Zwar ist zweifelhaft, ob dies noch von der Integrationsermächtigung aus Art. 23 Abs. 1 GG gedeckt wäre. Ein solches Risiko wird durch die Einschränkungen der vorläufigen Anwendung und die Erklärungen zum Ratsprotokoll betreffend den Gemischten CETA-Ausschuss jedoch ausgeschlossen. Soweit darüber hinaus die demokratische Legitimation und Kontrolle von Beschlüssen des Gemischten CETA-Ausschusses mit Blick auf Art. 20 Abs. 1 und 2 GG zweifelhaft erscheint, ist eine etwaige Berührung der Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) während der vorläufigen Anwendung von CETA ebenfalls nicht zu besorgen.
Das später erstattete Gutachten des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16. Mai 2017 zum Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Singapur (EUSFTA) ist für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung. Zwar weicht dieses in Bezug auf die mitgliedstaatlichen Kompetenzen in mehreren Punkten von der Beurteilung ab, die der Zweite Senat in seinem Urteil vom 13. Oktober 2016 über die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung im Zusammenhang mit CETA vorgenommen hat. Auf die Bewertung des hier in Rede stehenden Beschlusses des Rates wirkt sich dies jedoch nicht aus. Dessen verfassungsrechtliche Beurteilung bemisst sich nach dem Inhalt, den der Beschluss des Rates vom 28. Oktober 2016 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei verständiger Auslegung hat.
Sachverhalt:
2009 nahmen die Europäische Union und Kanada Verhandlungen über ein Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) auf. Das Abkommen soll der weiteren Stärkung der engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien und der Schaffung eines erweiterten und sicheren Marktes für Waren und Dienstleistungen durch den Abbau oder die Beseitigung von Handels- und Investitionshemmnissen dienen. Nach Abschluss der Verhandlungen unterbreitete die Europäische Kommission dem Rat der Europäischen Union im Juli 2016 den Vorschlag, die Unterzeichnung von CETA zu genehmigen, die vorläufige Anwendung zu erklären, bis die für seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind, und das Abkommen abzuschließen.
Mit Urteil vom 13. Oktober 2016 hat der Zweite Senat in den vorliegenden Verfahren Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die darauf zielten, die Unterzeichnung, vorläufige Anwendung und den Abschluss von CETA zu untersagen, nach Maßgabe der Gründe abgelehnt. Er hat ausgeführt, dass sich der Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung im Hauptsacheverfahren zwar möglicherweise als Ultra-vires-Akt herausstellen könne und auch eine Berührung der durch Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Verfassungsidentität nicht ausgeschlossen sei, weil es der Europäischen Union unter anderem an einer Vertragsschlusskompetenz für Portfolioinvestitionen, den Investitionsschutz, den internationalen Seeverkehr, die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und den Arbeitsschutz fehlen dürfte und eine Weiterübertragung von Hoheitsrechten auf das Gerichts- und das Ausschusssystem vom Grundgesetz nicht vorgesehen sei. Ein Ultra-vires-Akt könne jedoch ebenso wie eine unzulässige Berührung der Verfassungsidentität durch Ausnahmen von der vorläufigen Anwendung vermieden werden. Zudem müsse sichergestellt werden, dass Deutschland die vorläufige Anwendung von CETA auch einseitig beenden könne.
CETA wurde schließlich – auch da ein Großteil der Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebracht hatte, dass die Europäische Union nicht die erforderliche Zuständigkeit in zahlreichen von CETA geregelten Bereichen besitze – als gemischtes Abkommen behandelt. Am 28. Oktober 2016 beschloss der Rat der Europäischen Union die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung von CETA. Eine Reihe von Bereichen wurde von der vorläufigen Anwendung ausgenommen. Die Bundesregierung übermittelte ihre Zustimmung am 28. Oktober 2016. Am 21. September 2017 trat CETA vorläufig in Kraft. In 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union – darunter die Bundesrepublik Deutschland – ist das Verfahren zur Ratifikation noch nicht abgeschlossen. Auch die Ratifikation durch Kanada und die Europäische Union steht noch aus.
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in einem Gutachten zum Freihandelsabkommen EUSFTA im Mai 2017 festgestellt, dass die Europäische Union in allen von dem geplanten Abkommen erfassten Bereichen die ausschließliche Zuständigkeit besitze; ausgenommen seien lediglich andere Investitionen als Direktinvestitionen und die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat mit den Mitgliedstaaten als Beklagten.
Die Beschwerdeführer zu I. bis IV. rügen eine Verletzung ihres grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG. Die Antragstellerin zu V., die Fraktion Die LINKE im Deutschen Bundestag, macht in Prozessstandschaft Rechte des Bundestages geltend. Die Nichtablehnung von CETA durch die Bundesregierung verletze Gestaltungsrechte des Bundestages aus Art. 23 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 GG.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
Die Verfassungsbeschwerden und das Organstreitverfahren haben keinen Erfolg.
A. Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführer zu I. bis IV. und der Antrag der Antragstellerin zu V. im Organstreitverfahren sind nur teilweise zulässig.
I. Die Verfassungsbeschwerden sind, soweit sie sich gegen die Mitwirkung des deutschen Vertreters am Beschluss des Rates der Europäischen Union über die vorläufige Anwendung von CETA richten, zulässig.
II. Soweit sich die Verfassungsbeschwerden gegen die Unterzeichnung von CETA richten, sind sie unzulässig, weil von der Unterzeichnung keine unmittelbaren Rechtswirkungen für die Beschwerdeführer ausgehen. Ebenfalls unzulässig sind die Verfassungsbeschwerden, soweit sie sich gegen den noch ausstehenden Beschluss des Rates zum Abschluss von CETA richten, weil dieser Beschluss erst nach Ratifizierung durch sämtliche Mitgliedstaaten gefasst werden soll und zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine unmittelbaren Rechtswirkungen zeitigen kann. Unzulässig ist die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführer zu II. ferner, soweit diese sich gegen das zukünftige deutsche Zustimmungsgesetz wenden. Ein solches ist noch nicht verabschiedet worden.
B. Die Organklage der Antragstellerin zu V. ist ebenfalls nur teilweise zulässig.
I. Die Organklage ist zulässig, soweit sie sich gegen die Mitwirkung des deutschen Vertreters am Beschluss des Rates vom 28. Oktober 2016 über die vorläufige Anwendung von CETA richtet. Die Antragstellerin zu V. ist als Fraktion des Deutschen Bundestages im Organstreitverfahren berechtigt, dessen Rechte im Wege der Prozessstandschaft im eigenen Namen geltend zu machen.
II. Mangels unmittelbarer Rechtswirkungen unzulässig ist die Organklage dagegen, soweit sich die Antragstellerin zu V. gegen die Unterzeichnung und den Abschluss von CETA wendet. Das hat der Senat mit Blick auf den Antrag auf einstweilige Anordnung bereits im Urteil vom 13. Oktober 2016 ausgeführt.
C. Soweit die Verfassungsbeschwerden zulässig sind, sind sie offensichtlich unbegründet.
I. Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Gründung und Fortentwicklung der Europäischen Union mit. Art. 23 Abs. 1 GG enthält insoweit auch ein Wirksamkeits- und Durchsetzungsversprechen für das Unionsrecht, soweit das Grundgesetz und das Zustimmungsgesetz die Übertragung von Hoheitsrechten erlauben oder vorsehen. Nur in diesem Umfang ist die Anwendung von Unionsrecht in Deutschland demokratisch legitimiert. Das Bundesverfassungsgericht gewährleistet dies insbesondere im Rahmen der Identitäts- und der Ultra-vires-Kontrolle.
II. Die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Bundesrepublik Deutschland in den Organen und Gremien der Europäischen Union ist Ausübung deutscher Staatsgewalt. Bei seinem Verhandlungs- und Abstimmungsverhalten unterliegt der deutsche Vertreter im Rat grundgesetzlichen Bindungen. Der deutsche Vertreter im Rat der Europäischen Union verletzt daher das Recht der Bürgerinnen und Bürger aus Art. 38 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 und 2, Art. 79 Abs. 3 GG, wenn er an einem Rechtsakt mitwirkt, der eine Berührung der Verfassungsidentität oder einen Ultra-vires-Akt darstellt.
III. Die Mitwirkung des deutschen Vertreters am Beschluss des Rates der Europäischen Union über die vorläufige Anwendung von CETA vom 28. Oktober 2016 ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dieser ist weder als Ultra-vires-Akt zu qualifizieren, noch verstößt er gegen die Grundsätze des Demokratieprinzips im Sinne von Art. 20 Abs. 1 und 2 GG als Teil der Verfassungsidentität des Grundgesetzes.
1. Der Beschluss des Rates erstreckt sich unter Berücksichtigung der für seine Anwendung festgelegten Maßgaben nur auf Gegenstände, die unstreitig in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen. Soweit die Vertragsschlusskompetenz für Portfolioinvestitionen, den Investitionsschutz, den internationalen Seeverkehr, die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und den Arbeitsschutz umstritten ist, ist die vorläufige Anwendung beschränkt.
a) Soweit sich der Beschluss des Rates zur vorläufigen Anwendung von CETA als Ultra-vires-Akt darstellen könnte, weil mit CETA möglicherweise Hoheitsrechte auf das Gerichts- und das Ausschusssystem weiterübertragen werden und zweifelhaft ist, ob die Beanspruchung einer umfassenden unionalen Vertragsschlusskompetenz im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik, die eine entsprechende Mediatisierung der Mitgliedstaaten bedeutete und mit einem weitreichenden Eingriff in deren (Völker-)Rechtssubjektivität einherginge, noch von Art. 23 Abs. 1 GG gedeckt wäre, wird ein solches Risiko durch die nur eingeschränkte Anwendbarkeit von Kapitel 8 CETA (Investitionen) und die Erklärungen zum Ratsprotokoll betreffend den Gemischten CETA-Ausschuss ausgeschlossen. Insbesondere werden entsprechende Entscheidungen ausweislich der Erklärung Nr. 19 zum Ratsprotokoll einvernehmlich getroffen, wodurch eine Zustimmung des deutschen Ratsvertreters sichergestellt wird.
b) Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass die mitgliedstaatlichen Kompetenzen durch den Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA gewahrt worden sind. Jedenfalls ist durch die Einschränkungen, die dieser Beschluss erfahren hat, und die in diesem Zusammenhang abgegebenen Erklärungen ein offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Übergriff in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ausgeschlossen.
2. Eine Berührung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes und insbesondere der Grundsätze der Demokratie und der Volkssouveränität (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) durch den Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA scheidet ebenfalls aus.
a) Art. 26.1 CETA sieht einen Gemischten Ausschuss vor, der für alle Fragen zuständig ist, die die Handels- und Investitionstätigkeit zwischen den Vertragsparteien und die Umsetzung und Anwendung von CETA betreffen. Seine Beschlüsse sind für die Vertragsparteien – „vorbehaltlich der Erfüllung etwaiger interner Anforderungen und des Abschlusses etwaiger interner Verfahren“ – bindend und von ihnen umzusetzen. Zu den wichtigen Befugnissen des Gemischten Ausschusses gehört, soweit in CETA vorgesehen, die Befugnis, Änderungen des Abkommens zu beschließen und Protokolle und Anhänge zu ändern. Der Gemischte CETA-Ausschuss kann ferner durch Beschluss weitere Kategorien von geistigem Eigentum in die Begriffsbestimmung „Rechte des geistigen Eigentums“ aufnehmen. In Anbetracht der unklaren Regelung des Art. 30.2 Abs. 2 Satz 2 und 3 CETA kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Beschlüsse des Gemischten Ausschusses keiner Zustimmung durch die Vertragsparteien bedürfen. Auch wenn der Gemischte Ausschuss seine Beschlüsse einvernehmlich trifft, er daher Beschlüsse nicht gegen die Stimme der Europäischen Union fassen kann, gibt es insoweit doch keine gesicherte Einflussmöglichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Es erscheint daher denkbar, dass deutsche Stellen jedenfalls von unmittelbaren Einflussmöglichkeiten insoweit gänzlich ausgeschlossen werden, so dass eine personelle und sachliche Legitimation der Ausschusstätigkeit durch die Mitwirkung deutscher Hoheitsträger ebenso unmöglich wäre wie ihre Verantwortlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die demokratische Legitimation und Kontrolle derartiger Beschlüsse erscheint mit Blick auf Art. 20 Abs. 1 und 2 GG zweifelhaft.
b) Dies kann im vorliegenden Zusammenhang jedoch dahinstehen, weil durch die den Beschluss über die vorläufige Anwendung flankierenden Einschränkungen in den Erklärungen zum Ratsprotokoll eine Berührung des Demokratieprinzips ausgeschlossen ist. Insbesondere folgt aus Entstehungsgeschichte und Kontext der Erklärung Nr. 19, dass der von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten im Gemischten Ausschuss einzunehmende Standpunkt zu einem Beschluss dieses Gremiums immer einvernehmlich festgelegt wird. Das setzt eine Zustimmung des deutschen Vertreters im Rat der Europäischen Union voraus, so dass eine etwaige Berührung der Verfassungsidentität (Art. 79 Abs. 3 GG) durch Kompetenzausstattung und Verfahren des Ausschusssystems während der vorläufigen Anwendung von CETA nicht zu besorgen ist.
IV. Die verfassungsrechtliche Beurteilung der hier angegriffenen Mitwirkung des deutschen Vertreters am Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 28. Oktober 2016 bemisst sich nach dem Inhalt, den dieser Beschluss zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei verständiger Auslegung hat. Auf seine spätere Anwendung kommt es insoweit nicht an. Für den vorliegenden Fall ist daher ohne Belang, dass das CETA-Ausschusssystem im Rahmen der vorläufigen Anwendung des Abkommens aktiviert wurde. Die Bundesregierung hat allerdings bekundet, dass die Ausschüsse im Rahmen der vorläufigen Anwendung keine Beschlüsse über Bereiche treffen, die in die mitgliedstaatliche Kompetenz fallen. Nichts anderes gilt im Hinblick auf das nach der Beschlussfassung des Rates erstattete EUSFTA-Gutachten des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 16. Mai 2017, das in Bezug auf die mitgliedstaatlichen Kompetenzen im Bereich des internationalen Seeverkehrs, der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen und des Arbeitsschutzes von der Beurteilung abweicht, die dem Urteil des Senats vom 13. Oktober 2016 zugrunde lag. Für die Frage, ob die Bundesregierung mit der Zustimmung zum Beschluss des Rates über die vorläufige Anwendung von CETA vom 28. Oktober 2016 ihre Integrationsverantwortung verletzt hat, kommt es darauf nicht an. Allerdings bleiben die Verfassungsorgane verpflichtet, während der vorläufigen Anwendung ergriffenen Maßnahmen, die sich als Ultra-vires-Akt oder als Berührung der Verfassungsidentität erweisen, entgegenzutreten. Sollte dies nicht erfolgreich sein, verbleibt der Bundesregierung in letzter Konsequenz die Möglichkeit, die vorläufige Anwendung des Abkommens zu beenden.
D. Soweit zulässig, ist die Organklage der Antragstellerin zu V. aus denselben Gründen wie die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführer zu I. bis IV. offensichtlich unbegründet.
Straftatbestand „Verbotene Kraftfahrzeugrennen (§ 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB)“ mit dem Grundgesetz vereinbar
Beschluss vom 09. Februar 2022, 2 BvL 1/20
Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts § 315d Abs. 1 Nr. 3 des Strafgesetzbuches (StGB), der sogenannte Einzelrennen unter Strafe stellt, für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.
Nach Auffassung des vorlegenden Amtsgerichts verstößt die Norm gegen den in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgrundsatz. Der Zweite Senat hat nun entschieden, dass der Gesetzgeber den Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB hinreichend konkretisiert und so dem aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz folgenden Bestimmtheitsgebot Genüge getan hat. Insbesondere das subjektive Tatbestandsmerkmal „um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“ ist einer methodengerechten Auslegung durch die Fachgerichte zugänglich.
Sachverhalt:
Gemäß § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich im Straßenverkehr als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Dem Angeschuldigten des Ausgangsverfahrens wird unter anderem eine Straftat nach § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB zur Last gelegt. Angeklagt war im Wesentlichen eine drei bis vier Minuten andauernde Polizeifluchtfahrt des Angeschuldigten, bei der er – teils innerhalb geschlossener Ortschaften – Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h erreicht, dabei nacheinander insgesamt vier Lichtzeichenanlagen überfahren haben und mit einem Verkehrsteiler kollidiert sein soll. Während der Verfolgungsfahrt sei es dem Angeschuldigten durchgehend darauf angekommen, unter Berücksichtigung der Verkehrslage und der Motorisierung seines Fahrzeugs möglichst schnell zu fahren, um auf diese Weise die ihn verfolgenden Polizeibeamten abzuschütteln.
Das Amtsgericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die Vorschrift des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB verfassungsgemäß ist. Nach seiner Auffassung verstößt die Norm gegen den in Art. 103 Abs. 2 GG verankerten Bestimmtheitsgrundsatz.
Wesentliche Erwägungen des Senats:
§ 315d Abs.1 Nr. 3 StGB ist mit dem Grundgesetz vereinbar.
I. Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Für den Gesetzgeber enthält Art. 103 Abs. 2 GG in seiner Funktion als Bestimmtheitsgebot die Verpflichtung, wesentliche Fragen der Strafwürdigkeit oder Straffreiheit im demokratisch-parlamentarischen Willensbildungsprozess zu klären und die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, dass Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen. Das Bestimmtheitsgebot verlangt daher, den Wortlaut von Strafnormen so zu fassen, dass die Normadressaten im Regelfall bereits anhand des Wortlauts der gesetzlichen Vorschrift voraussehen können, ob ein Verhalten strafbar ist oder nicht.
II. Für die Strafgerichte konkretisiert der Satz „nulla poena sine lege“ den Grundsatz der Gewaltenteilung aus Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG. Sie dürfen nicht korrigierend in die Entscheidung des Gesetzgebers über die Strafbarkeit eingreifen. Sie sind allerdings gehalten, weit gefassten Tatbeständen innerhalb der Wortlautgrenze durch eine präzisierende Auslegung Konturen zu geben. Dabei sind die Strafgerichte verpflichtet, die einzelnen Tatbestandsmerkmale nicht so zu definieren, dass die vom Gesetzgeber dadurch bewirkte Eingrenzung der Strafbarkeit im Ergebnis wieder aufgehoben wird. Einzelne Tatbestandsmerkmale dürfen innerhalb ihres möglichen Wortsinns nicht so weit ausgelegt werden, dass sie vollständig in anderen Tatbestandsmerkmalen aufgehen, also zwangsläufig mit diesen mitverwirklicht werden (Verbot der Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen).
III. Eine Pflicht auch des Strafgesetzgebers, Tatbestandsmerkmale so zu formulieren, dass keines in einem anderen aufgeht, enthält Art. 103 Abs. 2 GG hingegen nicht. Angesichts seines aus dem Demokratieprinzip folgenden Einschätzungs- und Ermessensspielraums kann es dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, ihm zur Klarstellung wichtige, wenn auch ineinander aufgehende und damit im Ergebnis „verschleifende“ Tatbestandsmerkmale ausdrücklich in den Gesetzestext aufzunehmen. Um die Anforderungen des Bestimmtheitsgebots zu erfüllen, genügt es, dass der Gesetzgeber die Strafnormen so fasst, dass sich für den Normadressaten nach allgemeinen Maßstäben Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände erkennen und durch Auslegung ermitteln lassen.
IV. Nach diesen Maßstäben ist § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB mit dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG zu vereinbaren.
1. § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB lässt die erfassten Rechtsgüter der Sicherheit des Straßenverkehrs, des Lebens, der körperlichen Integrität und des Eigentums ebenso deutlich werden wie die besonderen Gefahren, vor denen der Gesetzgeber sie schützen will.
a) Die Tatbestandsmerkmale „grob verkehrswidrig“ und „rücksichtslos“, welche im Straßenverkehrsstrafrecht bereits bestehende Begriffe aufnehmen, sind durch die Judikatur hinreichend präzisiert.
b) Für das Tatbestandsmerkmal des Fortbewegens mit nicht angepasster Geschwindigkeit kann dem Wortlaut des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB der Bezugspunkt zur Bestimmung der nicht angepassten Geschwindigkeit zwar nicht unmittelbar entnommen werden. Dieser ergibt sich aber aus dem Regelungsgehalt der Vorschrift und der Gesetzesbegründung.
c) Hinsichtlich des Bezugspunkts der Tatbestandsmerkmale der groben Verkehrswidrigkeit und Rücksichtslosigkeit bestehen hinreichende Anknüpfungspunkte für eine methodengerechte Auslegung. Insbesondere kann der ausdrückliche Verweis in den Gesetzesmaterialien auf § 315c Abs. 1 Nr. 2 StGB – der ebenfalls als Bezugspunkt einen in der Norm aufgeführten Verkehrsverstoß voraussetzt – zur Auslegung herangezogen werden.
d) Auch der vom Gesetzgeber neu eingeführte Begriff der „höchstmöglichen Geschwindigkeit“ kann im Rahmen seines Wortsinns methodengerecht ausgelegt werden. Zur Bestimmung der Parameter, nach welchen sich die „höchstmögliche Geschwindigkeit“ bemisst, können die Gesetzesmaterialien herangezogen werden, welche ausdrücklich auf die Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnisse verweisen. Ferner lässt die Formulierung des Absichtsmerkmals eine Auslegung zu, nach der es nicht darauf ankommt, ob sich der Täter allein mit der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, fortbewegt oder noch weitergehende Beweggründe – wie beispielsweise die Flucht vor der Polizei oder den Wunsch nach öffentlicher Anerkennung durch späteres Einstellen eines Videos ins Internet – verfolgt.
2. Soweit das Absichtsmerkmal mit Blick auf die Abgrenzung zu noch straffreiem, allerdings womöglich nicht umfassend normkonformem oder rücksichtsvollem Verhalten im Straßenverkehr verbleibende Randunschärfen enthält, ist es einer Präzisierung durch die Rechtsprechung innerhalb des Wortsinns zugänglich. Die vom Bundesgerichtshof vorgenommene Interpretation des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB ist eine mögliche und methodengerechte Auslegung der Strafnorm. Wenn dieser davon ausgeht, dass sich die Zielsetzung des Täters nach seinen Vorstellungen auf eine unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten nicht ganz unerhebliche Wegstrecke beziehen müsse und sich nicht nur in der Bewältigung eines räumlich eng umgrenzten Verkehrsvorgangs erschöpfen dürfe, hält er sich im Rahmen der Wortlautgrenze des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und stellt methodengerecht auf die objektive Gefahrenlage ab. Er nimmt Verhaltensweisen im Straßenverkehr von der Strafbarkeit aus, die nach den Vorstellungen des Täters zwar auf das Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit zielen, sich aber subjektiv nur auf eine unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten unerhebliche Wegstrecke beziehen und damit im Grad der
abstrakten Gefahr nicht mit einem Kraftfahrzeugrennen vergleichbar sind. Diese Auslegung steht im Einklang mit gesetzessystematischen und teleologischen Erwägungen.
3. Diese Interpretation des Straftatbestands des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB hat eine Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen, die der Gesetzgeber eingrenzend verstanden hat, nicht zur Folge. Insbesondere berücksichtigt sie, dass das Absichtserfordernis nicht in der Definition der übrigen Tatbestandsmerkmale aufgehen darf. Dies ist für die beiden objektiven Tatbestandsmerkmale der nicht angepassten Geschwindigkeit und der groben Verkehrswidrigkeit bereits deshalb nicht der Fall, weil das Absichtserfordernis überschießend über die für diese beiden objektiven Tatbestandsmerkmale geforderte Vorsatzform des dolus eventualis hinausgeht. Das übersieht das vorlegende Gericht, welches sich letztlich auf eine eigene (verschleifende) Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB beschränkt, die es sodann am Verbot einer solchen Verschleifung misst.
V. Der Eingriff der Vorschrift des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB in die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG ist verhältnismäßig.
Die Belange des Gemeinschaftsschutzes überwiegen hier die Auswirkungen der Strafnorm des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB auf die allgemeine Handlungsfreiheit. Dahinter muss das Interesse, sich unter Verletzung der Straßenverkehrsordnung sowie der Missachtung von Rücksichtnahmepflichten gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern mit höchstmöglicher Geschwindigkeit fortbewegen zu wollen, zurücktreten.